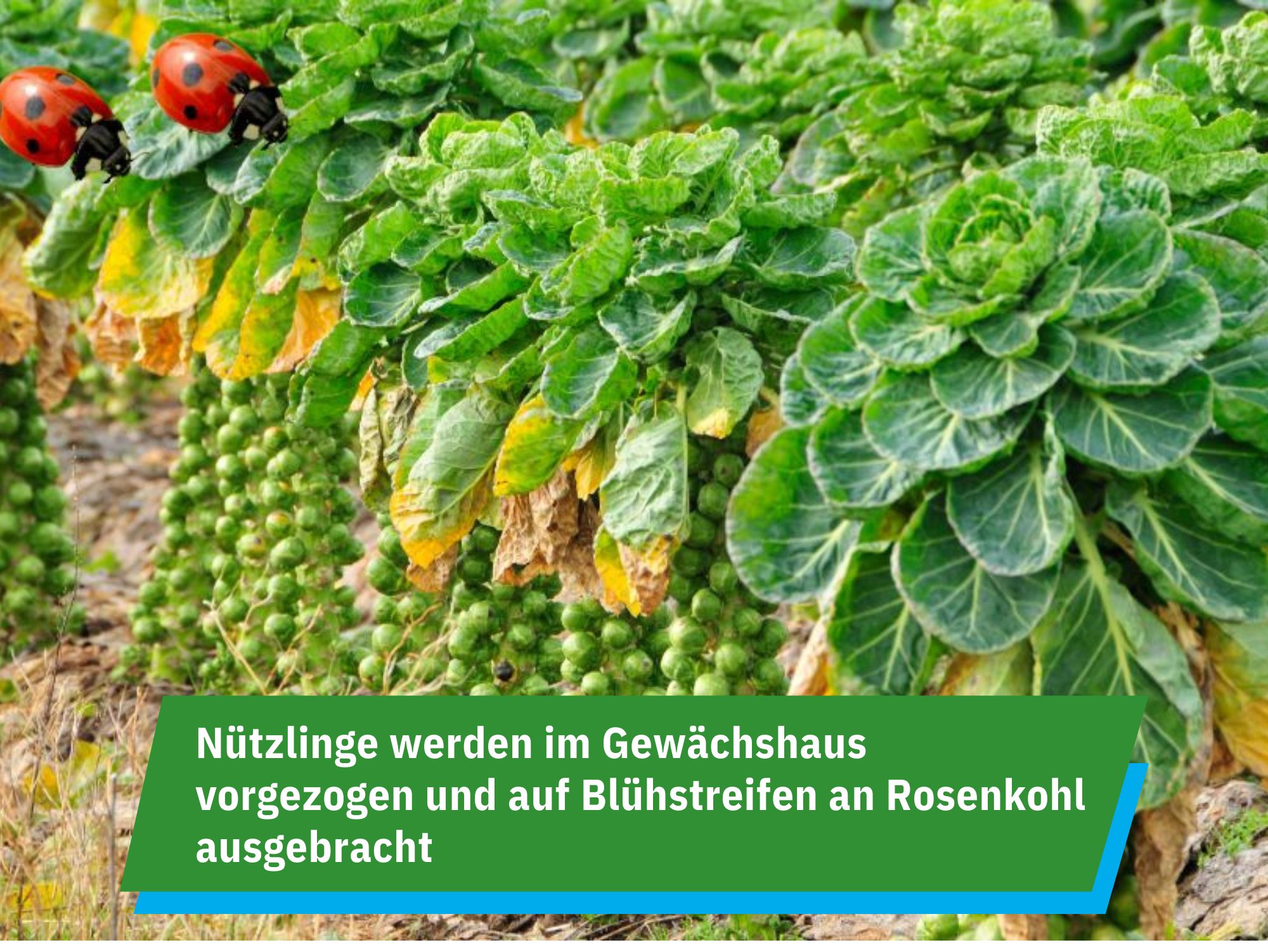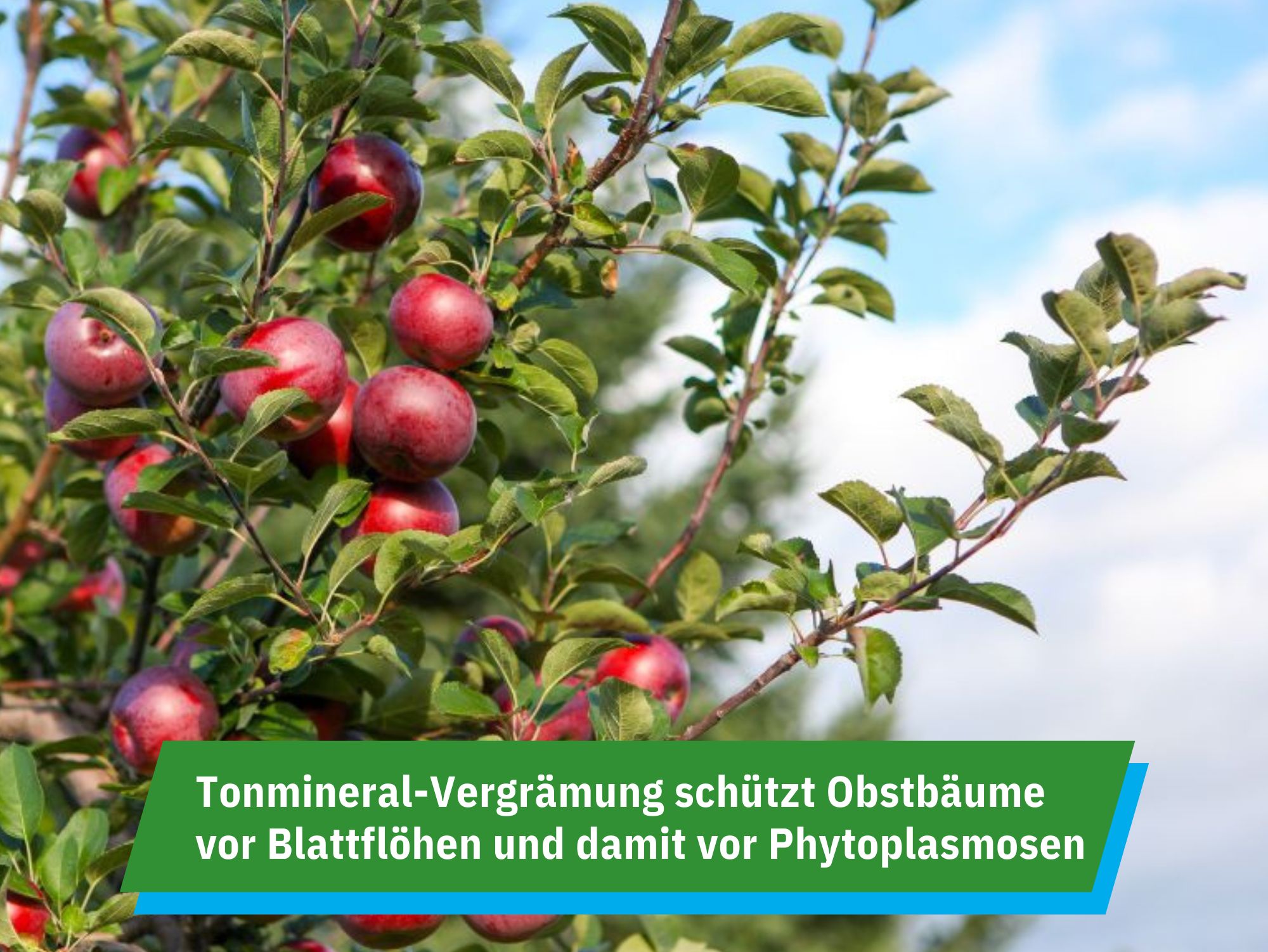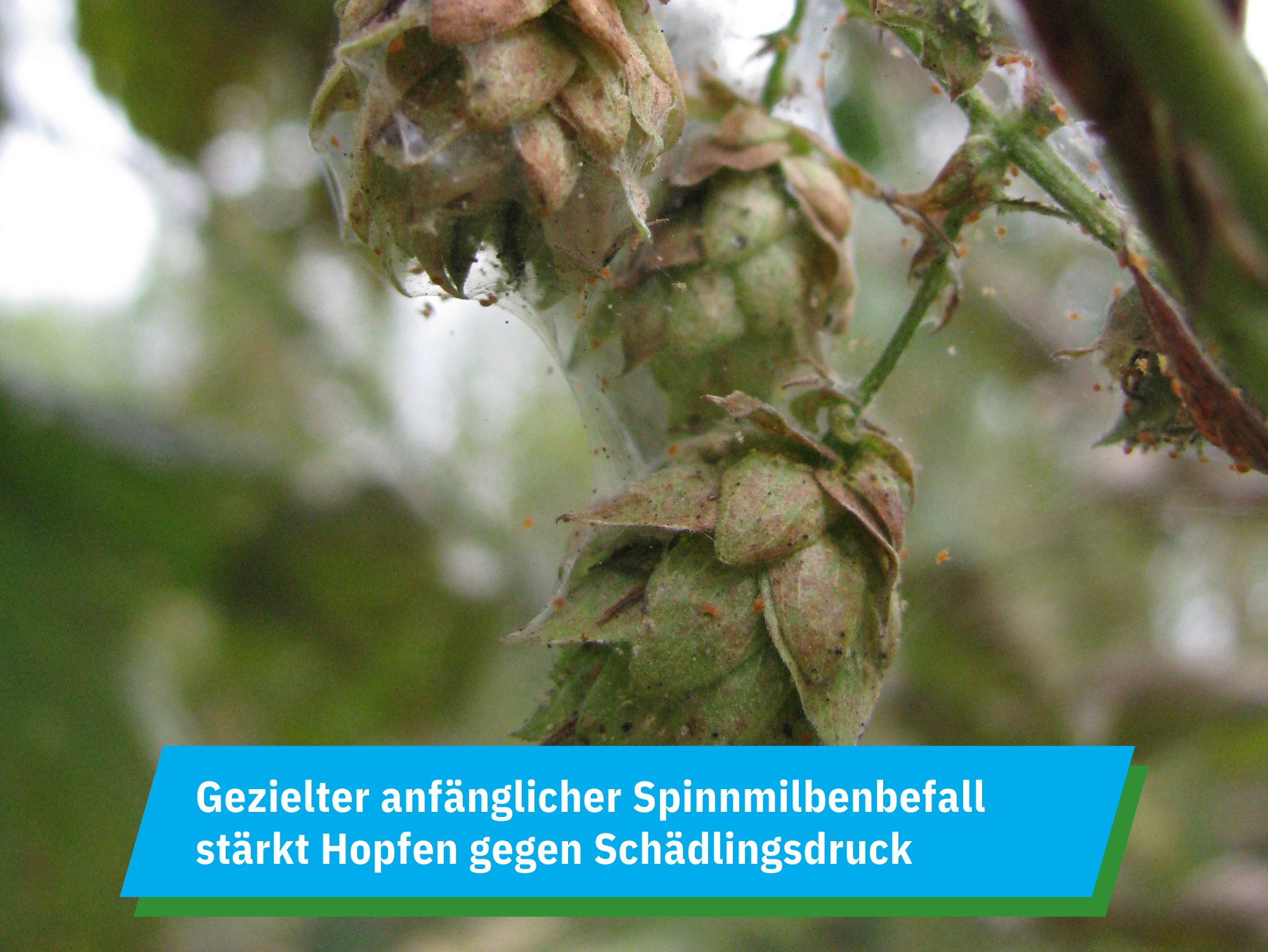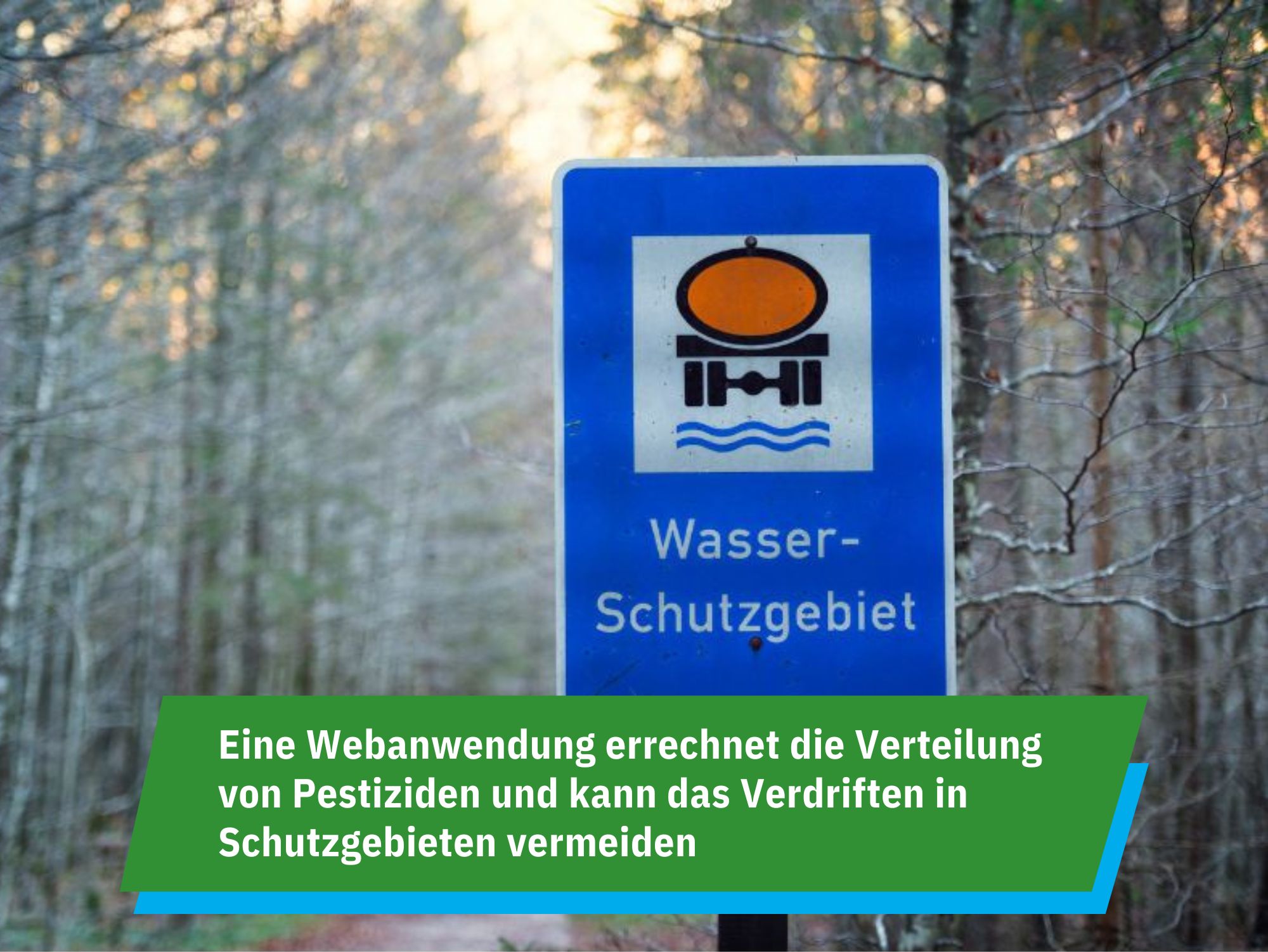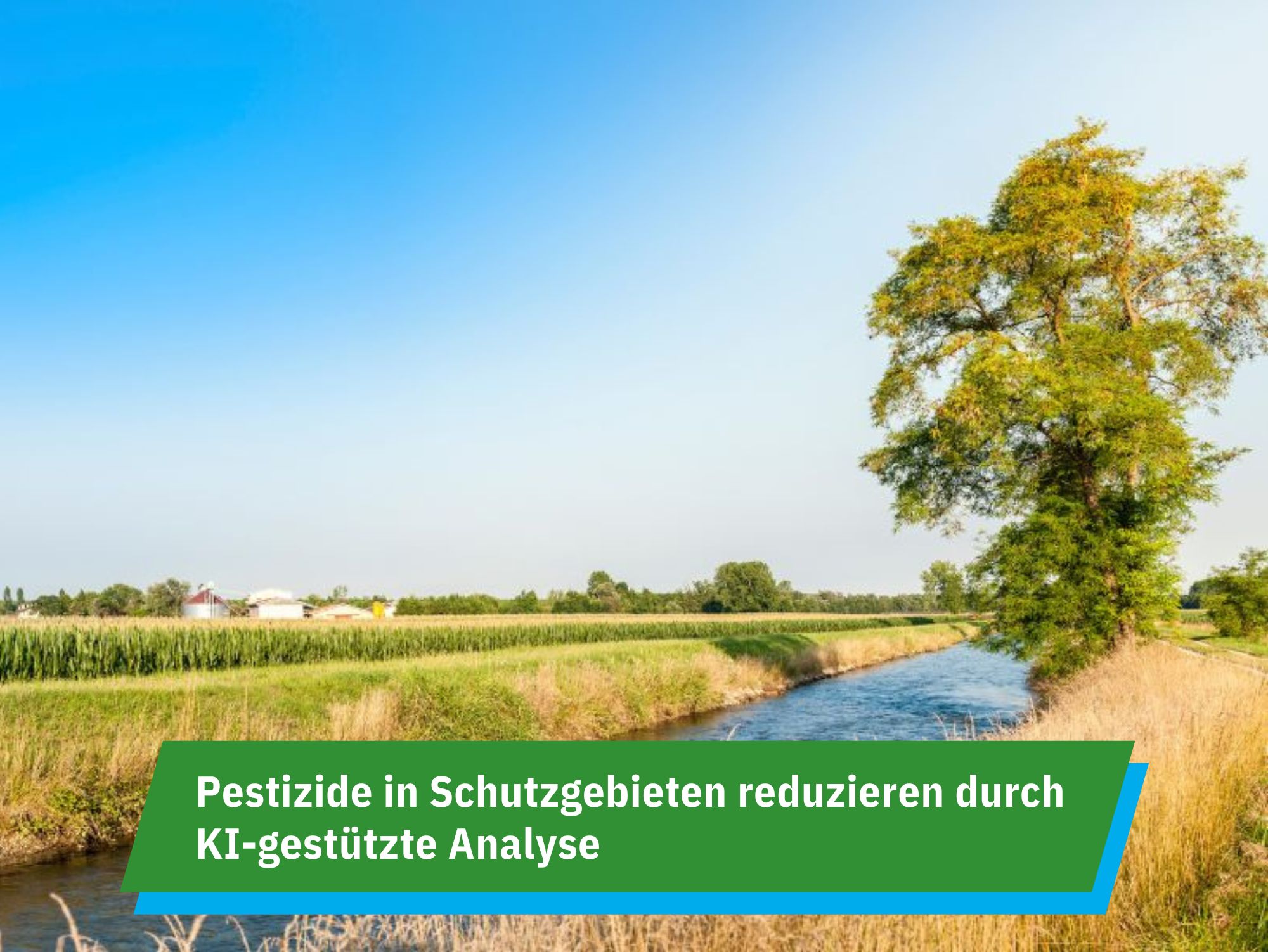Landwirtschaft im Wandel
Ein Blick zurück zeigt, dass sich die Art und Weise, wie wir Landschaft betreiben in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt hat: In den 1950er Jahren war die Landwirtschaft von kleinen Ackerflächen, viel Handarbeit und geringer Effizienz geprägt, während der Einsatz von chemischen Pflanzenschutz- und Düngemitteln noch minimal war. Heute dominieren hingegen großflächige, einheitlich bewirtschaftete Felder, leistungsstarke Landmaschinen und der intensive Einsatz von Dünger und Pestiziden. Gleichzeitig hat auch in der Tierhaltung ein Wandel stattgefunden: Statt in kleinen bäuerlichen Betrieben werden Nutztiere heute für die Fleisch-, Eier- und Milchproduktion überwiegend in Massentierhaltung gezüchtet.
Die Landwirtschaft steht vor einem Dilemma: Um stabile Erträge zu erzielen und die weltweite Ernährung zu sichern, setzt sie auf Pflanzenschutzmittel und nährstoffreiche Düngung. Die übermäßigen Nährstoffeinträge und der Einsatz von Pestiziden belasten Böden und Gewässer und gefährden die biologische Vielfalt. Hinzu kommt: Mit rund 95 Prozent ist die Landwirtschaft – insbesondere durch die Tierhaltung – der Hauptverursacher von Ammoniak-Emissionen in Deutschland.
Drei Stoffe – große Wirkung: Ammoniak, Nährstoffe und Pestizide belasten Boden, Wasser und Artenvielfalt. Ein Blick auf die drei Problemstoffe der Landwirtschaft.
Nachhaltige Landwirtschaft beginnt mit guten Ideen
Wie kann Landwirtschaft so gestaltet werden, dass sie uns zuverlässig ernährt, ohne dabei natürliche Lebensgrundlagen zu gefährden? Gefragt sind praxisnahe Alternativen, die Wege zu einer ressourcenschonenden, nachhaltigen Landwirtschaft aufzeigen. Wie diese aussehen können, zeigen eine Vielzahl von DBU-Projekten, von denen wir einige in diesem Kapitel vorstellen.
DBU-Generalsekretär Alexander Bonde spricht über die Herausforderungen nachhaltiger Landwirtschaft – und welche Rolle die DBU bei der Entwicklung zukunftsfähiger Lösungen übernimmt -> 🎧

Förderinitiative der DBU: Weniger Pestizide auf dem Acker
Im Januar 2020 hat die DBU die Förderinitiative „Vermeidung und Verminderung von Pestiziden“ gestartet, um gezielt innovative Lösungen für eine Landwirtschaft mit weniger Pestiziden zu fördern. Dabei liegt der Fokus darauf, praktikable Lösungen nicht nur in der ökologischen, sondern auch in der konventionellen Landwirtschaft voranzubringen und so Nachhaltigkeit und Biodiversität zu stärken.
Aus 78 eingereichten Projektskizzen wurden 16 Vorhaben ausgewählt und mit rund fünf Millionen Euro gefördert. Die Projekte entwickelten vielfältige Ansätze, darunter ackerbauliche, biologische, datenbasierte und physikalische Maßnahmen für unterschiedliche Kulturen – unter anderem für Kopfsalat, Möhren, Kernobst, Hopfen, Zuckerrüben und Ackerbohnen –, die nachfolgend beschrieben sind.
Ackerbauliche Maßnahmen
Ackerbauliche Maßnahmen können durch gezielte Bodenbearbeitung, Fruchtfolgeplanung und Anbautechniken die Umweltbelastungen reduzieren und die Bodengesundheit fördern. Dadurch kann der Einsatz von Pestiziden häufig reduziert werden.
Biologische Maßnahmen
Biologische Maßnahmen nutzen natürliche Mechanismen, um Schädlinge zu bekämpfen und die Umweltbelastung zu minimieren.
Datenbasierte Lösungsansätze
Innovative Technologien und digitale Ansätze sowie Künstliche Intelligenz (KI) können dazu beitragen, chemischen Pflanzenschutz im Land- und Gartenbau zu vermeiden und zu reduzieren. Die hier dargestellten drei Projekte zeigen, wie durch Vernetzung von Daten der Einsatz von Pestiziden so gesteuert werden kann, dass Schäden auf die Umwelt minimiert werden.
Physikalische Maßnahmen
Physikalische Maßnahmen umfassen mechanische, thermische und weitere physikalische Methoden, um Schädlinge, Krankheiten und Unkräuter zu bekämpfen, ohne chemische Mittel einzusetzen.

Weniger Pestizide – zu welchem Preis?
Wissenschaftler*innen des Öko-Instituts Freiburg begleiten im DBU-Projekt (AZ 37279) die Vorhaben der Förderinitiative Pestizidvermeidung über die gesamte Laufzeit. Sie bewerten die Nachhaltigkeit der Ansätze und analysieren, wo besonders viele Pestizide eingespart werden konnten. Auch Zielkonflikte werden systematisch erfasst und eingeordnet.
Denn: Weniger Pestizide haben ihren Preis. Alternative Methoden bringen zwar Vorteile für Biodiversität und Gesundheit, können aber auch Nachteile haben wie höhere Kosten oder einen erhöhten Einsatz von Energie, Wasser oder Fläche. Diese Zielkonflikte verdeutlichen, wie anspruchsvoll es ist, ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden.
Nachhaltigkeit vorgerechnet am Beispiel Möhrenanbau: Beim Möhrenanbau (AZ 37486) bietet eine computergesteuerte Methode zur Regulierung des Beikrauts mit Heißwasser eine Alternative zum Einsatz von Herbiziden und zur manuellen Beikrautbekämpfung. Der Einsatz von Heißwasser kann zwar den Herbizidverbrauch reduzieren, führt jedoch zu einem erhöhten Energie- und Wasserverbrauch. Wie nachhaltig ist Heißdampf also wirklich?
Um das herauszufinden, wurde der Einsatz von Heißdampf und Pestiziden im Möhrenanbau verglichen – mit Blick auf Energie- und Wasserverbrauch, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Ökosystemleistungen. Die Analyse zeigt: dass die Mehraufwände vergleichsweise gering sind und durch die erzielten Verringerungen im Herbizideinsatz gerechtfertigt sind.
Resümee und Ausblick
Die Projekte der DBU-Förderinitiative machen deutlich: Ein nachhaltigerer Umgang mit Böden, Wasser, Luft und landwirtschaftlichen Flächen ist möglich. Besonders zwei Lösungsansätze erscheinen vielversprechend: Technologische Innovationen wie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz bieten großes Potenzial, den Pestizideinsatz gezielt und ressourcenschonend zu reduzieren – etwa durch präzise Ausbringung oder bessere Prognosemodelle. Gleichzeitig leisten biologische Systeme wie Nützlinge einen wichtigen Beitrag zum Pflanzenschutz: Sie bekämpfen Schädlinge auf natürliche Weise und ermöglichen pestizidfreie Anbauverfahren.
Schutz für Oberflächen- und Grundwasser in landwirtschaftlichen Gebieten
Pestizide und Dünger wirken nicht nur auf dem Acker, sondern gelangen durch Versickerung, Oberflächenabfluss oder Abdrift in Flüsse, Seen, Küstengewässer und Grundwasser. Dadurch können die limnischen Ökosysteme aus dem Gleichgewicht geraten – mit Folgen für ihre vielfältigen Ökosystemleistungen wie die Trinkwasserversorgung, Nahrungsmittelproduktion, Energiegewinnung, den natürlichen Hochwasserschutz oder die Nährstoffregulation. Um diese lebenswichtigen Funktionen dauerhaft zu sichern, müssen die Einträge wirksam begrenzt werden. Wie das gelingen kann, zeigen exemplarisch drei DBU-Projekte.
Netzwerke als transformativer Hebel beim Gewässerschutz
Das Projekt in Kürze:
Bestehendes Wissen und Innovationen werden in Netzwerken zusammengeführt, um transformative Prozesse im Bereich von Gewässerschutz in der Land- und Forstwirtschaft voranzubringen. DBU-AZ 34124/01
Projektdurchführung: Universität Osnabrück
Weitere Informationen: https://www.dbu.de/projektdatenbank/34124-01/
Die Intensivlandwirtschaft wirkt sich im Nordwesten Deutschlands besonders negativ auf Oberflächengewässer, das Grundwasser und die Biodiversität aus. Eine hohe Viehdichte und die damit verbundene Produktion von Gülle sowie die intensive Düngung von Nutzpflanzen führen zu einem hohen Eintrag von Nährstoffen. Hinzu kommt, dass Grund- und Oberflächenwasser in Zeiten von Trockenheit verstärkt durch landwirtschaftliche Beregnungsanlagen sowie durch Wasserversorger und Gewerbebetriebe verbraucht werden. Die daraus lokal resultierende Grundwasserabsenkung beeinträchtigt angrenzende naturnahe Ökosysteme wie Still- und Fließgewässer sowie Moore und wirkt sich aber auch negativ auf die Forstwirtschaft aus.
Das transdisziplinäre DBU-Projekt Transformatives Landschaftsmanagement (T-LaMa) der Universität Osnabrück geht – basierend auf der langjährigen Forschung zum Water-Energy-Food Nexus – der Frage nach, wie innovative Kooperations- und Geschäftsmodelle dieser Entwicklung entgegenwirken und eine nachhaltigere Nutzung von Land und Ressourcen fördern können.