Warum trockene Böden Hitzewellen befeuern – Interview mit Prof. Dr. Sonia Seneviratne
Klimaforscherin Prof. Dr. Sonia I. Seneviratne hat die Wechselwirkungen zwischen Bodenfeuchte, Vegetation und Atmosphäre untersucht und in den internationalen Diskurs gebracht. Die Professorin von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) erklärt im Interview, was es damit genau auf sich hat und warum Klimaschutz und -anpassungen so wichtig sind.

Frau Prof. Dr. Seneviratne, Sie haben herausgefunden, dass trockene Böden Hitzewellen befeuern. Wie hängt das zusammen?
Bodenfeuchte hat einen direkten Einfluss auf Pflanzen, weil die Pflanzen das Wasser aus dem Boden verdunsten. Und das heißt, es führt zu einer Zufuhr von Feuchte in der Atmosphäre. Das beeinflusst auch den Niederschlag. Diese Verdunstung verbraucht viel Energie. Wenn die Böden trocken sind, dann wird diese Energie stattdessen in Hitze umgewandelt. Das ist ein bisschen wie beim menschlichen Körper: Solange wir schwitzen, haben wir einen Mechanismus, der den Körper eigentlich kühlt. Aber sobald wir nicht mehr schwitzen können, weil wir zu wenig getrunken haben, dann gibt es das Risiko von einem Hitzschlag.
Können Sie das noch mal konkret erklären und erläutern, wie Verdunstung mit unserem Klima zusammenhängt?
Der Boden und die Vegetation spielen eine wichtige Rolle beim Klima. Den Boden kann man sich wie ein Gefäß für Wasser vorstellen. Das Wasser wird von der Vegetation genutzt. Das kennt jeder, der Pflanzen zuhause hat: Gießt man sie nicht, dann vertrocknen sie. Und das passiert eben auch in unserer Umwelt. Wenn es zu trocken ist, dann sterben Pflanzen und Bäume. Pflanzen verdunsten sehr viel Wasser. Die Verdunstung beträgt auf der Erde im Durchschnitt ungefähr zwei Drittel vom Niederschlag, das sind etwa 60 Prozent. Das ist also ein sehr wichtiger Teil des Wasserkreislaufs, der aber kaum wahrgenommen wird, weil man ihn nicht sieht.
Dieser Kreislauf kann den Niederschlag und die Temperatur beeinflussen, weil er der Atmosphäre Feuchte zuführt und viel Energie verbraucht. Wenn der Boden aber trocken ist, führt das zu einer zusätzlichen Erwärmung der Atmosphäre, weil die Energie statt in Verdunstung, dann in Hitze umgewandelt wird. Außerdem spielen diese Prozesse eine sehr wichtige Rolle für den Kohlenstoffkreislauf. Denn mit dem Wachstum der Pflanzen wird CO2 aus der Atmosphäre aufgenommen. Wenn die Pflanzen aber unter Wasserstress leiden, oder gar absterben, dann hat man am Ende noch mehr CO2 in der Atmosphäre. Diese Zusammenhänge spielen also eine große Rolle für das globale Klima.
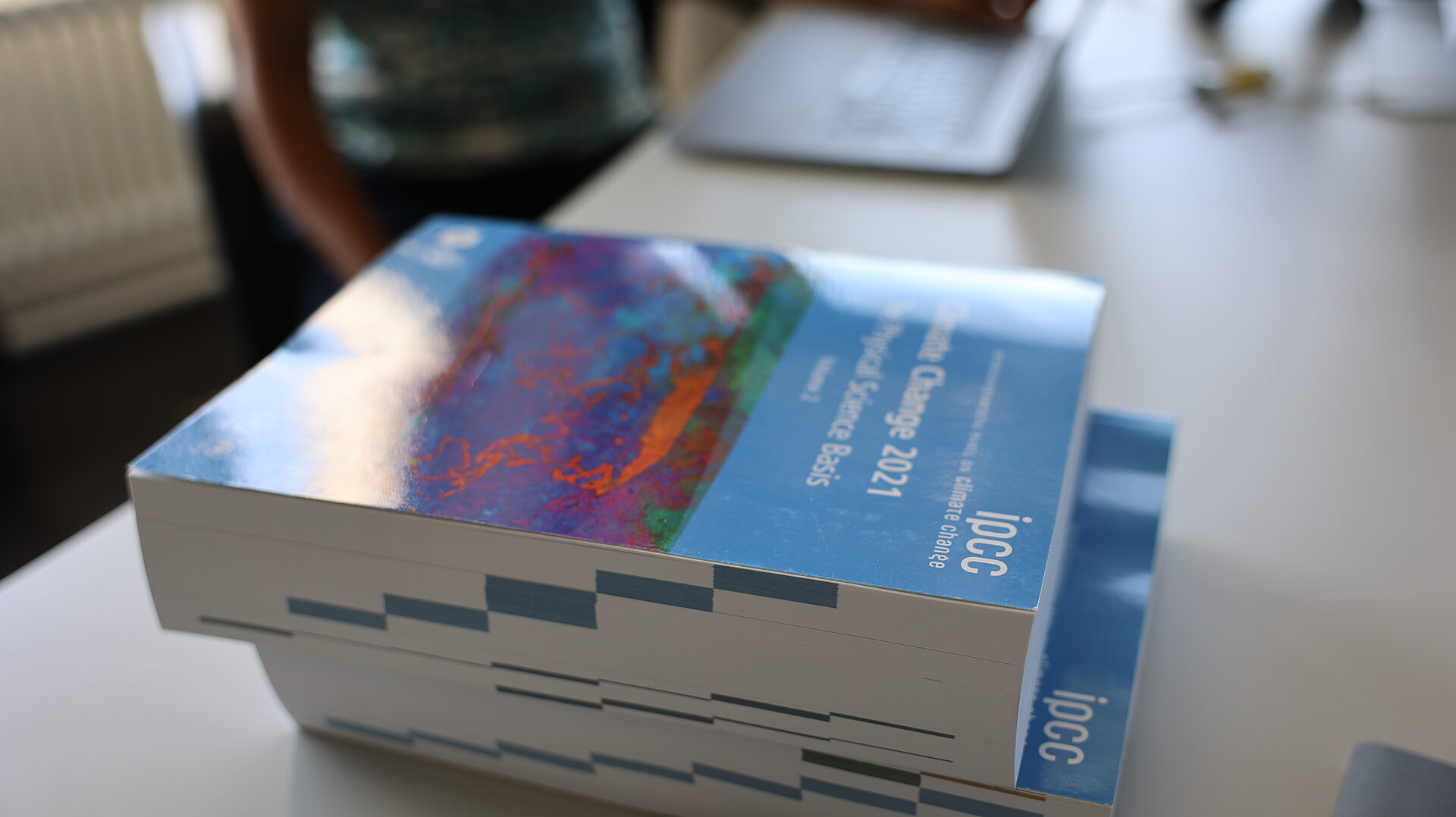
Sie waren entscheidend beteiligt an der Entwicklung eines Schweizer Bodenfeuchtemessnetzes, durch das Trockenheit früh erkannt werden kann. Warum ist so ein Messnetz überhaupt notwendig?
Wir haben 2008 gemeinsam mit Meteo Schweiz und Agroscope ein Bodenfeuchtemessnetz gestartet. Das Projekt wurde vom Schweizer Nationalfonds finanziert. Das Netz liefert Informationen über den Zustand der Bodenfeuchte. Wie bereits erwähnt, spielt Verdunstung eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Trockenheit, dennoch wird sie kaum gemessen. Sie beeinflusst das Austrocknen der Bodenfeuchte. Um diesen Prozess zu überwachen, braucht man entweder Messungen der Bodenfeuchte oder der Verdunstung – am besten beides. Niederschlagsmessungen sind zwar nützlich, genügen aber nicht, um die Bodenaustrocknung zu erfassen. Deshalb sind diese Messungen so wichtig. Insbesondere, wenn man Trockenheit früh erkennen möchte.
Die Klimaextreme nehmen zu, das zeigen ihre Forschungen. Können Sie da noch optimistisch in die Zukunft blicken?
Aufgrund der Klimaforschung wissen wir, dass wir große Veränderungen im Klima haben, als Folge der Verbrennung von fossilen Energieträgern. Die Verbrennung der fossilen Energieträger Erdöl, Gas und Kohle, führt zu Emissionen von CO2. Das Treibhausgas akkumuliert sich über Jahrhunderte in der Atmosphäre. Mit zunehmenden Konzentrationen von CO2 in der Atmosphäre nimmt die globale Erwärmung zu. Das führt auch zu einer Zunahme von verschiedenen Klimaextremereignissen, zum Beispiel Hitzewellen, Trockenheit und Starkniederschlägen in Zentraleuropa, wie es unsere Forschung gezeigt hat.
Die Lösung, um diese sich Jahr für Jahr verschlechternde Situation zu stemmen, ist: den Verbrauch von fossilen Energieträgern sehr schnell zu reduzieren und möglichst unabhängig von schädlichen Produkten zu werden. Die gute Nachricht ist, dass wir jetzt geeignete und zum Teil kostengünstige Alternativen haben. Solar- und Windenergie sind mittlerweile in vielen Fällen billiger als fossile Energieträger. Der Ausstieg macht also auch wirtschaftlich Sinn. Mit mehr Produktion von Elektrizität aus Sonnen- und Windenergie ist es möglich Verbrenner durch Elektroautos zu ersetzen, und Erdöl- oder Gasheizungen durch Wärmepumpen. Wir hier in Europa haben mit wenig Ausnahmen kaum Gas-, Erdöl- oder Kohlevorkommen – für uns gibt es demnach keinen Grund, dass wir uns so abhängig von fossilen Energieträgern machen.
Wichtig zu erkennen ist, dass der Status quo keine Option für die Zukunft ist. So oder so, die Welt wird sich verändern. Es hängt von uns als Menschen ab, in welche Richtung sie sich verändert: Wollen wir immer mehr Klimaextreme, die unsere Welt langsam, aber sicher zerstören oder wollen wir unsere Gewohnheiten leicht verändern, damit wir das behalten, was wir momentan haben? Wir haben es in der Hand.