Dialogprozess zum Aufbau eines Partnernetzwerkes mit der baltischen Wasserwirtschaft – BaltAqua
Keywords: Klimaschutz, Ressourcenschonung, Wasserwirtschaft, Networking, Umweltforschung, Umwelttechnik, Wissenstransfer, Innovative Kooperationsformate, Wassermanagement, Nachhaltige Regionalentwicklung, Grundwasser, Oberflächengewässer, Digitalisierung, Klimawandel, Governance, Nitratbelastung, Landwirtschaft, Wasserversorgung, Wasserressourcen, Wasserverfügbarkeit
Gegenstand und Ziele des Projektes
Mit dem sechsten Ziel für nachhaltige Entwicklung betonen die Vereinten Nationen, wie wichtig es ist, die Verfügbarkeit von sauberem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen für alle zu gewährleisten. Die Wasserwirtschaft in Deutschland steht jedoch vor wachsenden Herausforderungen, im Zuge derer klassische Lösungsansätze an ihre Grenzen stoßen. Dazu tragen u. a. Klimawandel, demographischer Wandel und neue Umweltauflagen bei, die hinsichtlich ihres Ausmaßes und ihrer Dynamik zu Unsicherheiten führen. Diese Probleme manifestieren sich vor allem auf lokaler und regionaler Ebene, wie in den nordwestlichen Regionen Niedersachsens, Deutschland, aber auch in den baltischen Staaten zu beobachten ist. Beide Regionen weisen vergleichbare geografische Merkmale und Nutzungsansprüche an die Ressource Wasser auf, die ein bislang noch weitgehend ungenutztes Potenzial für den Ausbau der Kooperation darstellen.
Vor diesem Hintergrund setzte sich das modellhafte Projektkonsortium im Projekt BaltAqua zum Ziel, ein Netzwerk mit wasserwirtschaftlichen Akteur*innen aus Deutschland und den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen aufzubauen und gemeinsam Handlungsfelder und Kooperationsprojekte für eine nachhaltige und zukunftsfähige Wasserversorgung zu entwickeln. Im Rahmen des Projektes wurden in der ersten Projektphase drei digitale Workshops durchgeführt, in denen mittels der interaktiven Methode „Liberating Structures“ zunächst die Basis für die zukünftige Zusammenarbeit geschaffen und folgende Kooperationsthemen als relevant identifiziert wurden:
- Nährstoffbelastung
- Management von Extremwetterereignissen im Kontext des Klimawandels
- Digitalisierung des Wassersektors als Querschnittsthema
In der zweiten Projektphase arbeiteten die Stakeholder*innen im Rahmen eines Präsenz-Workshops in Lettland die zuvor identifizierten Themen inhaltlich aus. In der dritten und letzten Projektphase wurde der Blick im Rahmen eines Präsenz-Workshops in Deutschland auf die Zukunft gerichtet: Mithilfe der Methode „Design Thinking“ gelang es, den Stakeholder*innen konkrete Strategien für die zukünftige Kooperation über die vier Länder hinweg zu entwickeln.
Durch das interaktive und kreative Workshop-Konzept und den gezielten Einsatz von innovativen Moderationsmethoden konnten über den Projektzeitraum hinweg nicht nur ein Wissenstransfer erreicht, sondern vor allem verlässliche Beziehungen sowie ein Netzwerk aufgebaut werden, in dem auch zukünftig gemeinsam an Projekten gearbeitet wird. Der gesamte Prozess wurde zudem durch ein sogenanntes „Graphic Recording“ begleitet und die Ergebnisse in einer Roadmap visualisiert und dokumentiert. Im Bereich nachhaltiges Management von Grundwasserkörpern und Einzugsgebieten wurde ein Wissenstransfer von Deutschland ins Baltikum und im Bereich digitaler Lösungsansätze in umgekehrter Richtung angestoßen. Auf den im Vorhaben erprobten Kooperationsstrukturen und den identifizierten Lösungsansätzen sollen zukünftige Projektansätze im Baltikum aufgebaut werden, die durch die DBU, aber auch durch weitere Fördermittelgeber*innen unterstützt werden.
Innovation und Modellhaftigkeit des Projektes
Im Projekt BaltAqua wurden zentrale Handlungsfelder identifiziert und von Praktiker*innen der Wasserwirtschaft und Wissenschaftler*innen aufgearbeitet. Der Modellcharakter des Netzwerkprojekts zeigt sich vor allem in der Schaffung und Erprobung innovativer Kooperationsformate und -methoden (z. B. Liberating Structures, Graphic Recording). Durch die enge Zusammenarbeit mit Netzwerkpartner*innen aus dem baltischen Raum und über den Wissenstransfer und die gemeinsame Entwicklung von Strategien und Projekten konnte eine das Projekt überdauernde Zusammenarbeit zwischen deutschen Akteur*innen und Institutionen aus dem Baltikum realisiert werden. Bedingt durch den Projektstart während der COVID-19-Pandemie diente das Projekt zudem als Experimentierraum für die Anwendung innovativer digitaler Tools. Im Projektverlauf konnte das Potenzial digitaler Formate für Kooperationsprojekte insbesondere in Kombination mit klassischen Präsenzformaten aufgezeigt werden.
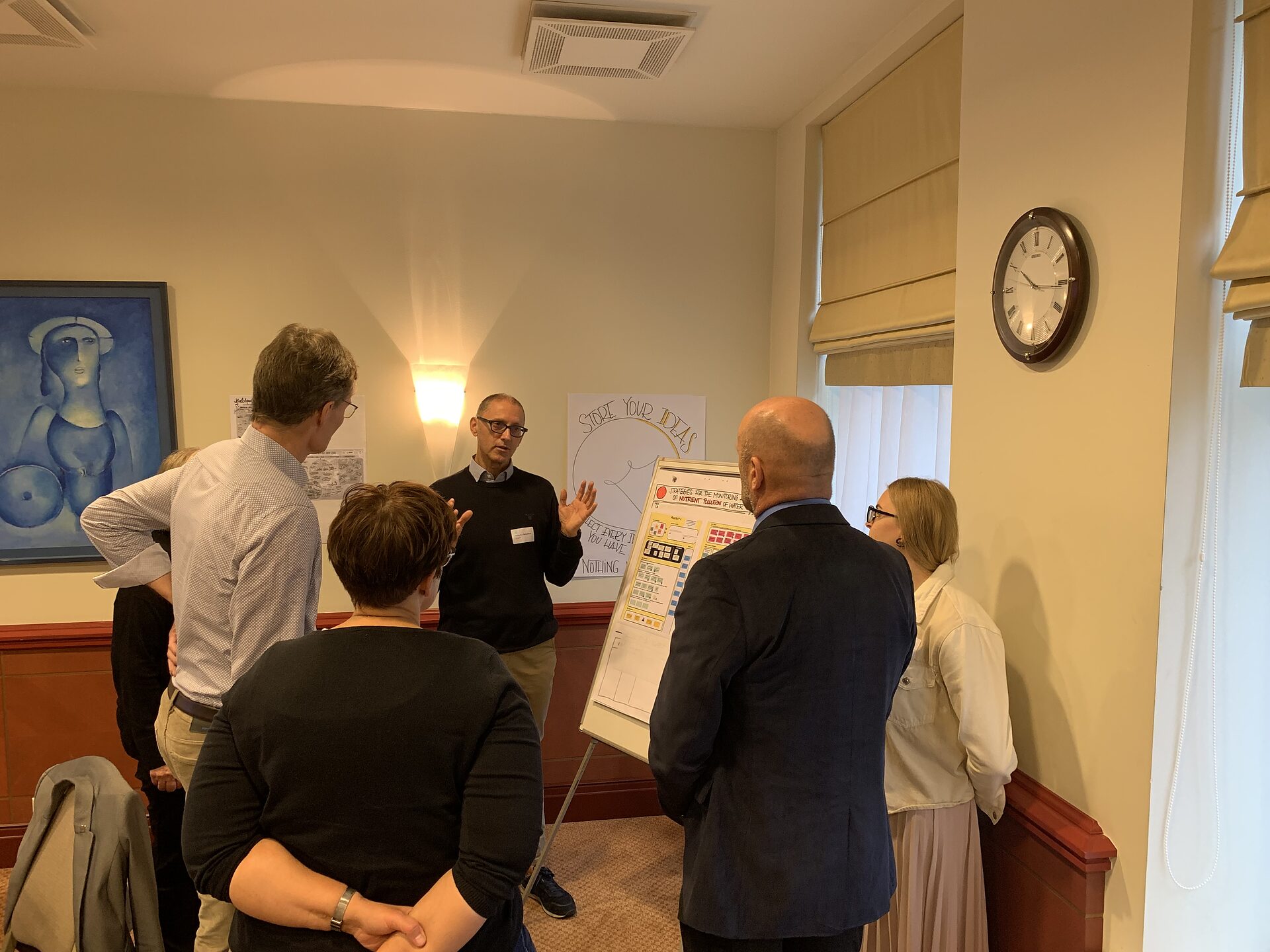


Förderthema 9: Naturschutz und Gewässerschutz
Projektdurchführung:
- Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband – OOWV, Brake, Niedersachsen
- Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Zentrum für Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung (COAST)
Assoziierte Partner*innen:
Wirkungsorte: Ostsee-Anrainerstaaten, insbesondere Lettland, Estland und Litauen
Förderzeitraum: September 2021 bis Juli 2024
Projektkosten: Gesamtvolumen: 144 618 Euro, Förderung durch DBU: 82 241 Euro
DBU-AZ: 35352
Stand: 19.05.2025
Bilder: © OOWV Brake